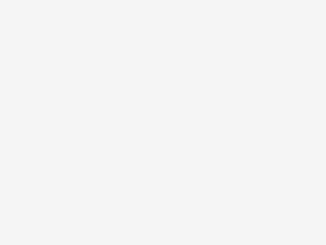
Die Linke und ihre Liebe zum Massenmörder Maduro
Von Tobias Käufer Die Linken-Fraktion macht sich für Nicolás Maduro stark – einen Mann, der in Venezuela seine Gegner ermorden lässt und Millionen Menschen in […]
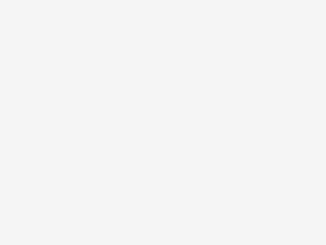
Von Tobias Käufer Die Linken-Fraktion macht sich für Nicolás Maduro stark – einen Mann, der in Venezuela seine Gegner ermorden lässt und Millionen Menschen in […]
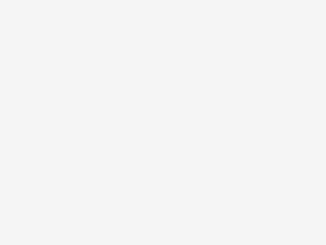
In Bogota wurde ein neues deutsch-kolumbianisches Friedensinstitut eröffnet. Zweifel an dieser Millioneninvestion sind angebracht. Von Tobias Käufer, Bogota Wer sich einmal die Mühe macht und […]
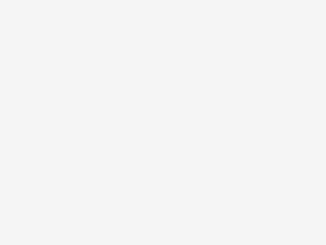
Das war eine krachende Niederlage. Doch anstatt die Gründe für die bitteren Ergebnisse zu aufzuarbeiten und seine Politik zu reformieren, setzt Venezuelas Präsident Nicolas Maduro […]
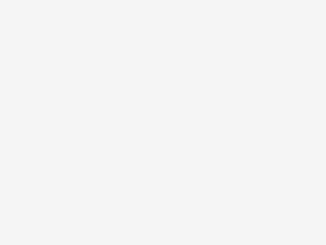
Das Monster sitzt im Klassenzimmer. Kokain, Heroin, Crystal Meth – die Kids wissen, wie sie an Drogen kommen. Es gibt nur ein Mittel gegen das […]
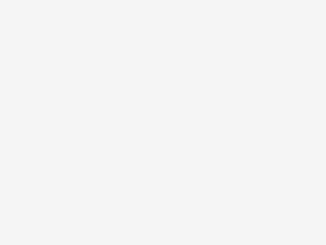
Venezuelas Demokratie schmiert ab: Erschossene Studenten, abgeschaltete unabhängige Radiosender, inhaftierte Oppositionspolitiker. Die Menschenrechts-Bilanz der regierenden Sozialisten in Caracas ist eine Katastrophe. Kommentar von Tobias Käufer […]
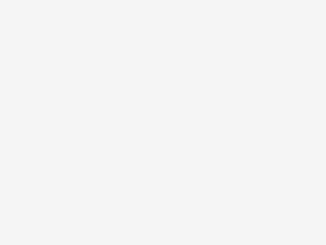
Von Tobias Käufer Der junge Hugo Chavez hält das kleine Büchlein mit der venezolanischen Verfassung in die Fernsehkameras. Warum um eine Erlaubnis fragen, die stehe […]
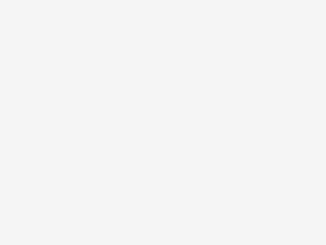
Von Tobias Käufer, Bogotá Die Angst ist verständlich: Sind erst einmal Drogen im freien Verkauf erhältlich, dann werden unsere Kinder und Jugendliche doch zur leichten […]
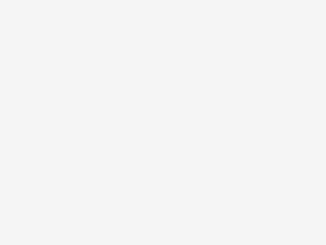
Uribe und Maduro: Verfeindete Zwillinge Von Tobias Käufer, Bogotá Als zu Beginn des Jahres in Venezuela Hunderttausende Menschen auf die Straße gingen, um gegen die […]
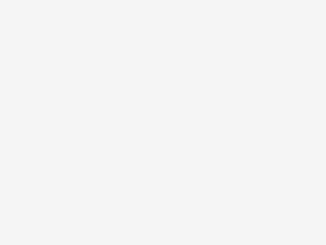
Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner will nicht zahlen. Mit der Pleite ihres Landes treibt sie ein gefährliches Spiel – auf Kosten anderer. Sie selbst hat wenig […]
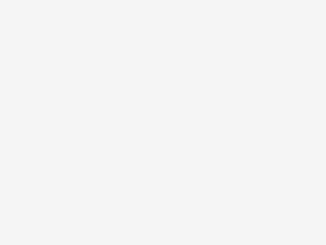
Analyse zum Ausgang des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahlen in Kolumbien Viele Lateinamerika-Interessierte fragen sich, warum der amtierende kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos im ersten Wahlgang […]
Copyright © 2025 | WordPress Theme von MH Themes